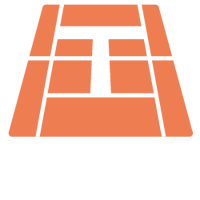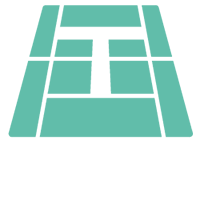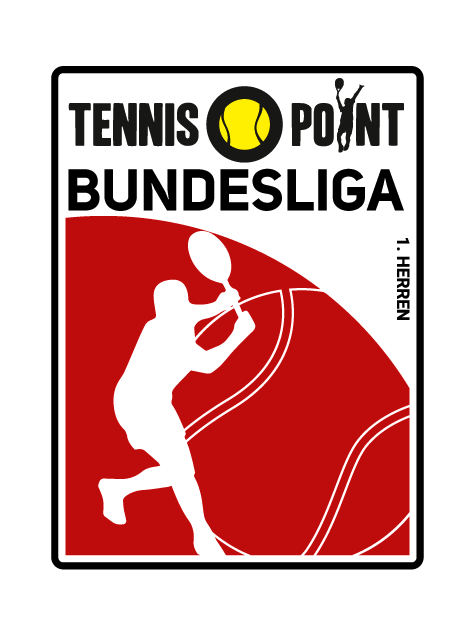News
Die Zukunft beginnt jetzt – tennis.de ist live!
tennis.de, die neue digitale Plattform des Deutschen Tennis Bund (DTB) und seiner Landesverbände, ist live. Egal ob Fan, Spieler:in, Trainer:in, Vereinsverantwortliche:r, Tennisinteressierte:r oder Schiedsrichter:in - tennis.de wird zukünftig die digitale Heimat des Tennissports in Deutschland.
May 2, 2024
Das ORTHOMOL-PAKET für deine Tennismannschaft
Tennis-Mannschaften aufgepasst! Unser langjähriger Ernährungspartner Orthomol Sport unterstützt auch in diesem Jahr wieder gezielt aktive Tennisspieler:innen. Bewirb dich jetzt für dein Team und gewinne mit ein wenig Glück eines der attraktiven „Mannschaftsaktionspakete“!
Apr 30, 2024
Für die Entwicklung des Tennissports: DTB und Porsche führen erfolgreiche Partnerschaft fort
Der Deutsche Tennis Bund (DTB) und die Porsche AG verlängern ihre langfristige Partnerschaft. Der Automobilhersteller fördert seit 2012 den Tennissport und unterstützt die deutsche Damennationalmannschaft sowie aufstrebende Nachwuchsspielerinnen im Porsche Talent Team und Porsche Junior Team.
Apr 30, 2024
Die mobile Ergebniserfassung über „mybigpoint KOMPAKT“
Einige Mannschaften haben bereits die Wettspielsaison 2024 mit dem ersten Punktspiel eröffnet. Erfasse alle Ergebnisse aus dem Wettspielbetrieb ganz einfach mobil über die Web App „mybigpoint KOMPAKT“ direkt vor Ort und mache dir das Leben leichter!
Apr 29, 2024
Laver Cup 2024: Rafael Nadal schlägt für Team Europe auf
Top-Star Rafael Nadal hat seinen Start für den Laver Cup, der vom 20. bis 22. September 2024 in der Berliner Uber Arena stattfindet, angekündigt. Noch vor dem offiziellen Verkaufsstart der Einzeltickets Mitte Mai können sich mybigpoint Mitglieder die begehrten Tickets in exklusiven Pre-Sales sichern!
Apr 24, 2024
Top-10-Star und Top-20-Spieler beim Generali Open 2024 in Kitzbühel
Das Generali Open Kitzbühel als Generalprobe für Olympia: Ein Top-10-Spieler, drei weitere Top-30-Spieler sowie die beiden Österreicher Sebastian Ofner und Dominic Thiem wollen sich beim Generali Open Kitzbühel vom 20. bis 27. Juli 2024 auf Paris vorbereiten.
Apr 24, 2024
Setze deine persönlichen Favoriten und habe alle Infos stets griffbereit
Speichere deine Spieler-, Mannschafts- und Turnierfavoriten mit einem Klick ab, um sie jederzeit einfach zu finden und schnell aufzurufen. So sparst du viel Zeit bei der Suche und bis perfekt organisiert!
Apr 23, 2024
Mit Beurer in die Tennissaison 2024: Jetzt 20 % Rabatt sichern!
Ob Trainer:in oder Spieler:in, Profi-, Nachwuchs- oder Freizeitsportler:in: Beim Ulmer Gesundheitsspezialisten Beurer findest du die passenden Begleiter für die Sandplatzsaison 2024 - perfekt für die Trainingstasche oder zur Regenration!
Apr 18, 2024
DTB und Blackroll verkünden Partnerschaft – Profitiere von 15% Einkaufsvorteil!
Regeneration und Faszientraining sind nicht nur im Spitzensport wichtig, sondern auch für Tennisspieler:innen aller Leistungsbereiche. Aufgrund der Kooperation des Deutschen Tennisbundes und Blackroll profitierst jetzt auch du von 15% Rabatt auf alle Blackroll Produkte!
Apr 17, 2024